Zweiter Nachfolgeversuch: 7 Erfolgsfaktoren für die Neuausrichtung
Ein gescheiterter Nachfolgeversuch ist schmerzhaft, aber kein Todesurteil.
Dr. Markus Dirr
5 min lesen
Ein gescheiterter Nachfolgeversuch ist schmerzhaft, aber kein Todesurteil. Im Gegenteil: Mit der richtigen Strategie kann der zweite Anlauf zum Ausgangspunkt einer langfristig erfolgreichen Entwicklung werden. Entscheidend ist, aus den Fehlern zu lernen und die Nachfolgestrategie systematisch anzupassen.
Im Kapitel „Wenn der Nachfolger scheitert" aus dem Buch „Lebenswerk mit Zukunft" zeigt Dr. Markus Dirr, wie Familienunternehmen nach einem Scheitern erfolgreich neu durchstarten können. Als externer Geschäftsführer einer Management-Holding im Familienbesitz kennt er die Herausforderungen und die Lösungswege aus hunderten begleiteten Prozessen.
1. Systematische Ursachenanalyse als Fundament
Der erste Schritt für einen erfolgreichen zweiten Versuch ist eine ehrliche und tiefgehende Ursachenanalyse. Feedback aus mehreren Perspektiven schafft ein vollständiges Bild. Die Perspektiven von Senior, Nachfolger, Führungsteam, Mitarbeitern und Kunden liefern wertvolle Einsichten. Diese können durch strukturierte Interviews, moderierte Gruppengespräche oder anonyme Befragungen erfasst werden.
Eine strukturierte Analyse fragt nach den tieferen Wurzeln der sichtbaren Symptome. Statt nur die offensichtlichen Probleme zu betrachten, geht es darum, die zugrundeliegenden Faktoren zu identifizieren. Die Fünf-Warum-Technik kann hilfreich sein: Bei jedem Problem wird fünfmal „Warum?" gefragt, um von den Symptomen zu den eigentlichen Ursachen vorzudringen.
Eine tabufreie Betrachtung erfordert den Mut, auch schwierige Themen anzusprechen. Externalisierung des Analyseprozesses kann helfen, blinde Flecken zu überwinden.
2. Anpassung der Nachfolgestrategie
Eine präzise Profilschärfung definiert klar, welche Kompetenzen wirklich erfolgskritisch sind. Diese Fragen sollten zunächst unabhängig von konkreten Kandidaten beantwortet werden. Brauchen wir einen Visionär oder einen Umsetzer? Sind Branchenkenntnisse wichtiger als Führungserfahrung? Welche Persönlichkeitsmerkmale passen zur Unternehmenskultur?
Die Erweiterung des Kandidatenkreises öffnet neue Perspektiven. Nach einem gescheiterten ersten Versuch ist Offenheit für verschiedene Nachfolgemodelle wichtig – von Familienmitgliedern über langjährige Führungskräfte bis hin zu externen Lösungen oder Tandem-Modellen.
Eine gründliche Prozessoptimierung strukturiert den Übergabeprozess in überschaubare Phasen. Statt eines großen „Alles-oder-nichts"-Übergangs empfiehlt sich eine schrittweise Übergabe mit eigenen Zielen für jede Phase.
3. Professionelle Governance-Strukturen etablieren
Der Aufbau professioneller Governance-Strukturen schafft Stabilität und Objektivität. Eine klare Rollenklärung für den Senior muss viel konkreter und verbindlicher erfolgen als beim ersten Versuch.
Dr. Dirr schildert den Fall einer diversifizierten Familienholding, die eine schwere Krise erlebte, als der designierte Nachfolger nach 15 Monaten als CEO zurücktrat. Der charismatische Gründer hatte weiterhin wichtige Entscheidungen selbst getroffen und seinem Sohn öffentlich widersprochen. Nach einer Konsolidierungsphase wurde der Beirat als professionelles Kontrollorgan neu aufgesetzt, mit drei externen Mitgliedern und verbindlichen Entscheidungsbefugnissen. In einem moderierten Prozess wurde ein klares Anforderungsprofil entwickelt. Die Lösung: Der Sohn kehrte als Co-CEO zurück, an seiner Seite ein erfahrener externer Manager. Der Vater zog sich vollständig aus dem operativen Geschäft zurück und übernahm den stellvertretenden Beiratsvorsitz.
Ein Beiratsmitglied resümiert: „Der entscheidende Erfolgsfaktor war ein offener Reflexionsprozess über die wirklichen Ursachen des Scheiterns. Alle Beteiligten mussten Kompromisse eingehen – aber heute steht das Unternehmen stärker da als je zuvor."
4. Systematischer Kompetenzaufbau
Mit der Erfahrung des ersten Scheiterns kann der Kompetenzaufbau zielgerichteter erfolgen. Eine präzise Gap-Analyse identifiziert konkrete Entwicklungsfelder. Wo liegen die größten Unterschiede zwischen dem erforderlichen Kompetenzprofil und den tatsächlichen Fähigkeiten? Diese Analyse sollte ehrlich und faktenbasiert sein, ohne den Nachfolger zu demotivieren.
Ein maßgeschneiderter Entwicklungsplan konkretisiert den Weg zur Kompetenzsteigerung. Für die identifizierten Lücken wird ein individueller Plan mit konkreten Maßnahmen erstellt – durch formale Bildung, Coaching, Mentoring oder praktische Erfahrungen.
Erfahrungslernen außerhalb des eigenen Unternehmens erweitert den Horizont. Gezielte Einsätze in anderen Unternehmen können wertvolle Erfahrungen vermitteln, die im eigenen Unternehmen nicht gesammelt werden können.
Die Entwicklung authentischer Führungskompetenz verdient besondere Aufmerksamkeit, da viele Nachfolger nicht an fachlichen, sondern an Führungsherausforderungen scheitern.
5. Professionelle externe Unterstützung
Ein zweiter Nachfolgeversuch sollte nicht ohne externe Unterstützung gewagt werden. Ein professioneller Beirat bringt nicht nur zusätzliche Expertise ein, sondern dient auch als neutrales Gremium bei Konflikten. Die Besetzung sollte sorgfältig erfolgen, mit Fokus auf Unabhängigkeit, relevante Erfahrung und persönliche Integrität.
Persönliches Coaching schafft einen geschützten Raum für Reflexion und persönliche Entwicklung. Im vertraulichen Rahmen können persönliche Herausforderungen und Entwicklungsbedarfe offen thematisiert werden.
Mentoring durch erfahrene Unternehmer ermöglicht wertvolles Lernen aus fremden Erfahrungen. Besonders wertvoll sind Mentoren, die selbst eine Nachfolge erfolgreich gestaltet haben.
Vereinbarte Mediationsangebote können bei Konflikten helfen, bevor diese eskalieren. Ein vorher vereinbarter Zugang zu professioneller Mediation schafft einen institutionalisierten Weg zur Konfliktbearbeitung.
6. Verbindliche Verantwortungsbereiche und Übergangsphasen
Mit der richtigen Vorbereitung kann der zweite Versuch zum Erfolg führen. Verbindliche Verantwortungsbereiche schaffen Klarheit und verhindern Kompetenzüberschneidungen. Eine Matrix, die verschiedene Entscheidungstypen klar zuordnet, gibt allen Beteiligten Orientierung.
Definierte Übergangsphasen ermöglichen einen schrittweisen, kontrollierten Übergang. Ein gestuftes Vorgehen mit klaren Zielen für jede Phase erlaubt kontinuierliches Lernen und Anpassen. Vereinbarte Kommunikationsregeln beugen Missverständnissen vor. Eine positive Zukunftsrolle des Seniors erleichtert das Loslassen. Eine klare Rückzugsvereinbarung schafft Sicherheit für alle Beteiligten.
7. Aufbau von Vertrauen und gemeinsamer Vision
Transparente Entscheidungen helfen, Vertrauen aufzubauen. Die klare Kommunikation von Entscheidungsgrundlagen hilft dem Senior, die Denkweise des Nachfolgers zu verstehen. Regelmäßige Feedbackschleifen helfen, blinde Flecken zu erkennen. Ein Fokus auf gemeinsame Erfolge stärkt das Vertrauen und schafft Momentum.
Ein gemeinsamer Visionsprozess erhöht die Qualität der Vision und schafft Identifikation. Die Balance von Tradition und Innovation verbindet Generationen und nutzt die Stärken beider Seiten. Eine langfristige Perspektive entspricht dem Wesen von Familienunternehmen.
Praxisbeispiel: Traditionelles Weingut
Dr. Dirr schildert ein traditionsreiches Weingut, das in eine Krise geriet, als die Nachfolgerin das Weingut ökologisch zertifizieren wollte. Nach einem heftigen Streit verließ sie das Familienunternehmen. Die Wiederannäherung begann durch Initiative des Vaters, der erkannte, dass der Markt sich in die von seiner Tochter vorgeschlagene Richtung entwickelte. Mit Hilfe eines Mediators starteten beide einen Dialog über fachliche Themen. Der Durchbruch kam mit einem Pilotprojekt, bei dem die Tochter drei Hektar eigenverantwortlich bewirtschaften konnte. Die Erfolge dieses „Weingut im Weingut" überzeugten auch die skeptischen Mitarbeiter. Nach diesem ersten Erfolg entwickelten Vater und Tochter gemeinsam einen Fünfjahresplan für die Betriebsübergabe. Heute, sieben Jahre nach dem gescheiterten Versuch, ist das Weingut vollständig auf ökologischen Anbau umgestellt und wirtschaftlich erfolgreicher als je zuvor.
Warum „Lebenswerk mit Zukunft" einzigartig ist
Das Besondere an diesem Buch ist der konsequent externe Blick. Alle 14 Autoren sind externe Beobachter und Begleiter von Familienunternehmen. Sie sehen Muster und blinde Flecken, die den Beteiligten selbst nicht bewusst sind. Das Buch bietet authentische Erfahrungen aus hunderten begleiteten Nachfolgeprozessen, konkrete Handlungsempfehlungen für sofortige Umsetzung, ehrliche Darstellung von Erfolgen und Misserfolgen sowie Zugang zur Community und direkten Kontakt zu allen Autoren.
Ihre nächsten Schritte
Wenn Sie vor einem zweiten Nachfolgeversuch stehen, nutzen Sie die Erkenntnisse aus dem ersten Scheitern. Führen Sie eine systematische Ursachenanalyse durch, passen Sie die Nachfolgestrategie an, etablieren Sie professionelle Governance-Strukturen, investieren Sie in Kompetenzaufbau, holen Sie externe Unterstützung, definieren Sie klare Verantwortungsbereiche und bauen Sie Vertrauen durch Transparenz auf.
Den vollständigen Originalbeitrag „Wenn der Nachfolger scheitert" von Dr. Markus Dirr finden Sie im Buch „Lebenswerk mit Zukunft". Einen kostenlosen Auszug können Sie unter www.Lebenswerk-mit-Zukunft.de herunterladen.
Die erfolgreichen Familienunternehmen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie keine Rückschläge erleben – sondern durch ihre Fähigkeit, aus diesen Rückschlägen zu lernen und gestärkt daraus hervorzugehen.
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
14 Experten teilen Erfahrungen für erfolgreiche Nachfolge, Führung und Unternehmensentwicklung
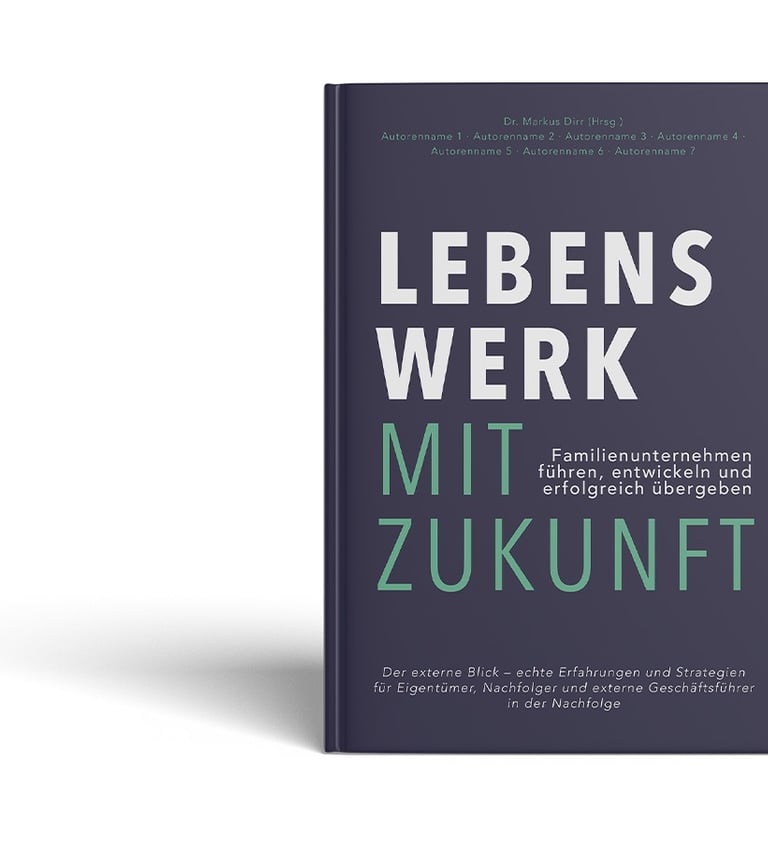
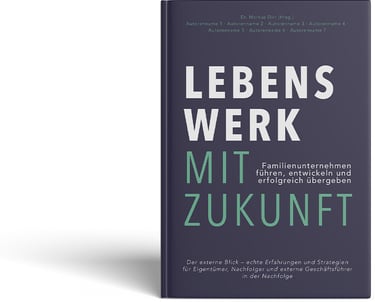
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
Lebenswerk mit Zukunft
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
