Wie viel Kapital brauche ich wirklich nach dem Unternehmensverkauf? Realistische Finanzplanung für Unternehmer
Berechnen Sie präzise, wie viel Kapital Sie nach dem Unternehmensverkauf benötigen. Philipp Degen erklärt Bruttoverkaufserlös, Steuern und steuerliche Optimierungsmöglichkeiten.
Dr. Markus Dirr
4 min lesen
Bevor Sie in Verkaufsverhandlungen einsteigen, beantworten Sie eine grundlegende Frage: Was brauchen Sie, um Ihren Lebensstandard nach dem Verkauf dauerhaft zu sichern? Diese Betrachtung ist der Ausgangspunkt jeder soliden Strategie – doch die meisten Unternehmer überspringen diesen Schritt.
In seinem Beitrag aus dem Buch „Lebenswerk mit Zukunft" zeigt Philipp Degen, M&A-Experte und Gründer von unternehmer-radio.de, mit konkreten Rechenbeispielen, wie Sie Ihren Kapitalbedarf ermitteln und welche steuerlichen Fallstricke Sie kennen müssen.
Die Realität des Käufermarktes
Zunächst die unbequeme Wahrheit: Großes Angebot trifft auf wenige Käufer. Je kleiner Ihr Unternehmen, desto höher das Risiko. Bei kleinen Unternehmen gibt es oft nur zwei bis vier ernsthafte Interessenten. Diese Ausgangslage erfordert präzise Finanzplanung.
Praxisbeispiel GmbH: Die vollständige Kalkulation
Nehmen wir einen monatlichen Nettobedarf von 10.000 Euro an, was einem jährlichen Bedarf von 120.000 Euro entspricht. Bei einer konservativen Nettorendite von 4 Prozent benötigen Sie ein Grundkapital von 3.000.000 Euro, um diesen Lebensstandard dauerhaft zu sichern.
Doch Vorsicht: Diese 3 Millionen Euro sind der Nettoerlös nach allen Abzügen. Jetzt wird es kompliziert. Nach Abzug von Verkaufsgebühren (etwa 10 Prozent für M&A-Provisionen, Notar-, Berater- und Gutachterkosten) und Steuern benötigen Sie einen Bruttoverkaufserlös von etwa 3.300.000 Euro.
Bei einer GmbH greift das Teileinkünfteverfahren: 60 Prozent des Verkaufspreises sind steuerpflichtig, 40 Prozent steuerfrei. Mit einem Gesamtsteuersatz von rund 45 Prozent verringert sich Ihr Nettoerlös erheblich – Sie müssen deshalb einen entsprechend höheren Bruttoverkaufspreis erzielen. Die Differenz zwischen Brutto- und Nettoerlös überrascht viele Unternehmer negativ.
Steuerliche Vergünstigungen bei Personengesellschaften
Bei Personengesellschaften und Verkäufern über 55 Jahren bestehen interessante steuerliche Optimierungsmöglichkeiten. Der Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG beträgt 45.000 Euro auf den Veräußerungsgewinn, wird allerdings bei höheren Gewinnen gestaffelt reduziert.
Alternativ können Sie die Steuerermäßigung nach § 34 EStG nutzen: Der Veräußerungsgewinn wird mit einem ermäßigten Steuersatz besteuert, der etwa 56 Prozent Ihres individuellen Steuersatzes beträgt, mindestens aber 14 Prozent. Diese Vergünstigung können Sie nur einmal im Leben in Anspruch nehmen – planen Sie also strategisch.
Ein wichtiger Unterschied: Bei Personengesellschaften wird der gesamte Veräußerungsgewinn voll versteuert, während beim Teileinkünfteverfahren nur 60 Prozent steuerpflichtig sind. Dies führt meist zu einem geringeren Nettoerlös bei Personengesellschaften. Die Wahl der Rechtsform kann also erhebliche finanzielle Auswirkungen haben.
Holding-Strukturen: Der Königsweg mit Vorlaufzeit
Die wohl effizienteste steuerliche Optimierung bietet eine Holding-Struktur. Mit einem Vorlauf von 5 bis 7 Jahren lässt sich der Steuersatz beim Verkauf auf etwa 1,5 Prozent senken – eine dramatische Ersparnis gegenüber den üblichen 30 Prozent bei GmbHs. Diese Gestaltung erfordert jedoch professionelle Beratung und rechtzeitige Planung.
Der Clou: Ihre GmbH-Anteile werden in eine Holding überführt, die beim späteren Verkauf von der Beteiligungsprivilegierung nach § 8b KStG profitiert. Doch Vorsicht vor Gestaltungsmissbrauch – die Finanzverwaltung prüft genau, ob die Holding wirtschaftliche Substanz hat oder nur der Steueroptimierung dient.
Typische steuerliche Fehlerquellen vermeiden
Die häufigsten steuerlichen Fehler beim Unternehmensverkauf sind versäumte Freibeträge, ungeeignete Rechtsformwahl, problematische Übergangsregelungen, unberücksichtigte Pensionszusagen und nicht geklärte Steuerrisiken aus der Vergangenheit. Jeder dieser Fehler kann Sie sechsstellige Beträge kosten.
Holen Sie sich deshalb professionelle Hilfe – aber nicht von Ihrem gewohnten Steuerberater, der Ihre sonstigen Themen bearbeitet, sondern von Spezialisten mit M&A-Erfahrung. Diese kennen die spezifischen Fallstricke und Optimierungsmöglichkeiten beim Unternehmensverkauf und haben Erfahrung mit verschiedenen Gestaltungsvarianten.
Der Mythos vom garantierten Multiplikator
Branchen-Multiplikatoren sind nur ein erster Anhaltspunkt, keine Garantie. Käufer analysieren in der Due Diligence jeden Wertfaktor – von Kundenbindung bis IT-Risiken. Ein Beispiel: Ein mittelständischer Maschinenbauer wurde zunächst mit dem Sechsfachen des EBIT beworben. Die Prüfung ergab jedoch eine kritische Abhängigkeit von nur drei Großkunden. Das Ergebnis: Der Käufer reduzierte den Multiplikator auf das Vierfache, was einen Wertverlust von über einer Million Euro nach sich zog.
Vorsicht auch bei überhöhten Multiplikatoren, wie sie das Finanzamt für Erbschaftssteuer akzeptiert (zum Beispiel Faktor 13,75). Dieser Wert ist für steuerliche Zwecke gedacht, nicht für den Markt. Kein Käufer möchte erst im 14. Jahr nach dem Kauf die Investition amortisiert sehen.
Flexible Verkaufsstrukturen als Erfolgsfaktor
Ob Sie auf den Maximalpreis pochen oder bereit sind, mit flexiblen Preisgestaltungen einen passenden Nachfolger zu gewinnen, entscheidet oft über den Verkaufserfolg. Große Unternehmen bringen meist ausreichend Eigenkapital mit. Bei MBI-Kandidaten wird die Finanzierung schnell zur größten Hürde, insbesondere wenn Banken involviert sind.
Verkäuferdarlehen und Earn-Out-Modelle können hier Lösungen bieten. Beim Verkäuferdarlehen gewähren Sie dem Käufer 20 bis 40 Prozent des Kaufpreises als Darlehen mit Rückzahlung in Raten. Earn-Outs koppeln Teile des Kaufpreises an das Erreichen definierter Ziele nach dem Verkauf – vom Umsatz über Kundenerhalt bis zu Produktentwicklungen.
Diese Modelle reduzieren das Käuferrisiko und erhöhen Ihre Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss, binden Sie allerdings auch noch Jahre an das Unternehmen. Eine sorgfältige Abwägung ist essentiell.
Professionelle Bewertung als Realitätscheck
Der gefühlte Unternehmenswert weicht oft stark vom marktfähigen Wert ab. Eine professionelle, unabhängige Unternehmensbewertung durch Spezialisten – nicht durch Ihren eigenen Steuerberater – schafft Klarheit, schützt vor überzogenen Preisvorstellungen und liefert wertvolle Argumente für Verhandlungen mit potenziellen Käufern.
Eine neutrale Bewertung zeigt Ihnen auch, an welchen Stellschrauben Sie noch drehen können, um den Wert zu steigern: von der Professionalisierung des Managements über die Dokumentation von Prozessen bis zur Modernisierung der Geschäftsmodelle.
Der erfolgreiche Unternehmensverkauf beginnt also nicht mit der Käufersuche, sondern mit der präzisen Kalkulation Ihres Kapitalbedarfs und der strategischen Steuerplanung. Nur wer diese Hausaufgaben macht, kann realistische Preisvorstellungen entwickeln und souverän verhandeln.
Den vollständigen Originalbeitrag von Philipp Degen finden Sie im Buch „Lebenswerk mit Zukunft" und einen kostenlosen Auszug unter www.Lebenswerk-mit-Zukunft.de. Das Buch ist einzigartig, weil alle 14 Autoren externe Begleiter von Familienunternehmen sind und den objektiven Blick mitbringen, der für erfolgreiche Transformationen entscheidend ist – ohne familiäre Betriebsblindheit, dafür mit authentischen Einblicken in hunderte Nachfolgeprozesse.
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
14 Experten teilen Erfahrungen für erfolgreiche Nachfolge, Führung und Unternehmensentwicklung
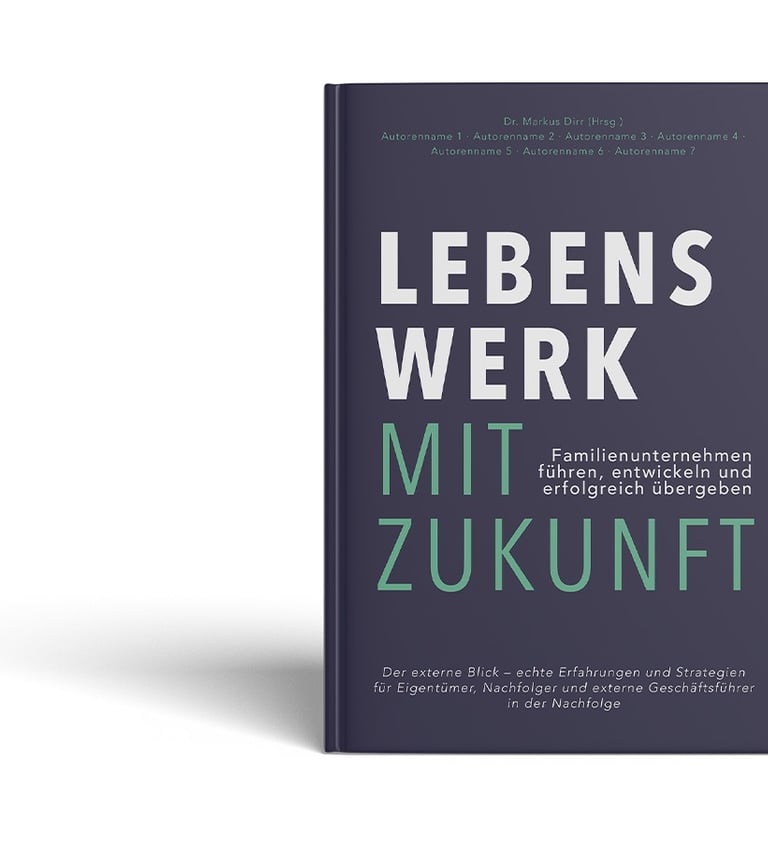
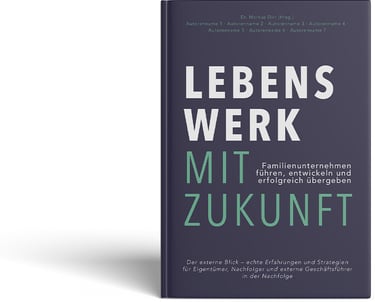
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
Lebenswerk mit Zukunft
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
