Vaude vs. Schlecker: Warum manche Nachfolgen glänzen und andere scheitern
Beitragsbeschreibung
Dr. Markus Dirr
3 min lesen
Zwei deutsche Familienunternehmen, zwei Nachfolgeprozesse, zwei völlig unterschiedliche Ausgänge. Die Geschichte von Vaude und Schlecker zeigt exemplarisch, woran Nachfolgen scheitern oder gelingen. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Verfügbarkeit von Ressourcen oder Marktchancen, sondern in der grundsätzlichen Haltung zur Nachfolge.
Diese aufschlussreichen Fallbeispiele stammen aus dem Beitrag „Nachfolge braucht Neuanfang: Warum Denkmalpflege kein Geschäftsmodell ist" von Dr. Bernd Müssig, einem renommierten Organisationsentwickler und Executive Coach, der seit über 15 Jahren Familienunternehmen bei Transformation und Nachfolge begleitet.
Fallbeispiel 1: Vaude – Transformation durch mutigen Wandel
Als Antje von Dewitz 2009 die Geschäftsführung des Outdoor-Unternehmens Vaude von ihrem Vater übernahm, stand sie vor einem etablierten Mittelstandsunternehmen mit funktionierendem Geschäftsmodell. Das Unternehmen war profitabel, hatte einen guten Ruf und eine treue Kundschaft. Sie hätte einfach weitermachen können wie bisher – viele Nachfolger entscheiden sich für diesen scheinbar sicheren Weg.
Doch Antje von Dewitz entschied sich bewusst gegen Bewahrung und für konsequente Transformation. Sie setzte auf radikale Nachhaltigkeit, faire Produktionsbedingungen und kreislaufwirtschaftliche Ansätze – Themen, die damals noch nicht im Mainstream waren. Diese Entscheidung war riskant, denn sie bedeutete Investitionen ohne garantierte Rendite.
Die Transformation war nicht einfach, doch Antje von Dewitz blieb konsequent. Sie nutzte die Nachfolge als strategischen Neuanfang. Das Ergebnis: Vaude wurde zum Vorreiter und zur glaubwürdigen Nachhaltigkeitsmarke, die heute als Benchmark der Branche gilt.
Was macht diesen Fall so bemerkenswert? Es ist der Mut, Bewährtes zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, ohne die Identität des Unternehmens zu verlieren. Vaude blieb ein Outdoor-Unternehmen, aber mit einer völlig neuen strategischen Ausrichtung. Die Tradition wurde nicht aufgegeben, sondern weiterentwickelt.
Fallbeispiel 2: Schlecker – Das Ende durch Erstarrung
Anders verlief die Entwicklung bei Schlecker. Das Drogerie-Imperium war über Jahrzehnte erfolgreich mit einem klaren Konzept: günstige Preise, dichte Filialnetze, Fokus auf Effizienz. Doch als sich der Markt veränderte, reagierte das Unternehmen nicht.
Schlecker hätte seine Marktposition nutzen können, um in E-Commerce, moderne Ladenkonzepte oder spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen zu investieren. Die Ressourcen waren vorhanden. Doch stattdessen wurde am veralteten Discountmodell festgehalten, während Wettbewerber wie dm und Rossmann innovierten.
Während dm auf Beratung und Kundenerlebnis setzte und Rossmann digitale Kanäle erschloss, blieb Schlecker beim alten Modell. Die Läden wirkten zunehmend unattraktiv, die Marke verlor an Relevanz. Das Ergebnis: Insolvenz im Jahr 2012 und das Ende einer einstigen Erfolgsgeschichte mit über 50.000 Mitarbeitern.
Was lässt sich aus diesem Scheitern lernen? Der Fehler lag nicht in mangelnder Kompetenz oder fehlenden Mitteln. Er lag in der Denkmalpflege-Mentalität – dem Glauben, dass das Gestrige auch morgen funktioniert. Tradition wurde als Schutzschild gegen Wandel verstanden.
Der entscheidende Unterschied: Haltung zur Nachfolge
Was unterscheidet Vaude von Schlecker? Die zentrale Frage ist: Wird Nachfolge als Übergaberitual verstanden oder als strategischer Neuanfang?
Bei Vaude wurde die Nachfolge als Chance begriffen, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Die neue Führung nutzte den Generationswechsel bewusst als Katalysator für Transformation. Bei Schlecker wurde Nachfolge als Fortsetzung des Bestehenden verstanden. Der Wunsch, das Lebenswerk zu bewahren, verhinderte die notwendige Weiterentwicklung.
Diese unterschiedlichen Haltungen führten zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Vaude zeigt: Mut zum Wandel wird belohnt. Schlecker zeigt: Erstarrung wird bestraft. Der Markt verzeiht vieles, aber nicht Stillstand.
Was bedeutet das für Ihre Nachfolge? Beide Beispiele lehren: Die Balance zwischen Tradition und Innovation ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, alles Alte über Bord zu werfen, sondern das Bewährte als Fundament zu nutzen, um Neues zu schaffen.
Eine gelingende Nachfolge ehrt die Vergangenheit, ohne an ihr zu kleben. Sie ermöglicht das Neue, ohne das Alte abzuwerten. Der entscheidende Mindset: Nachfolge ist nicht das Ende einer Geschichte, sondern der Anfang einer neuen.
Die Kunst besteht darin, drei Fragen ehrlich zu beantworten: Welche Traditionen sind wirklich zukunftsfähig? Welche Gewohnheiten verhindern Innovation? Und welcher Mut ist nötig, um den Unterschied zu erkennen?
Wer diese Fragen klärt, schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Nachfolge. Nicht das Festhalten sichert Relevanz, sondern der Wille zur Neugestaltung. Wer diesen Schritt geht, wird feststellen: Nachfolge ist die größte unternehmerische Chance, die ein Familienunternehmen hat.
Den vollständigen Originalbeitrag findest du im Buch „Lebenswerk mit Zukunft" von Dr. Markus Dirr (Hrsg.). Das Werk vereint 14 externe Experten mit über 300 Jahren kombinierter Erfahrung. Einen kostenlosen Auszug findest du unter www.Lebenswerk-mit-Zukunft.de
Was macht dieses Buch so besonders? Es ist kein theoretisches Handbuch, sondern eine Sammlung gelebter Praxis. Jedes Kapitel basiert auf realen Fallbeispielen und endet mit konkreten Handlungsempfehlungen. Der durchgängig externe Blick aller Autoren deckt blinde Flecken auf, die von innen nicht sichtbar sind.
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
14 Experten teilen Erfahrungen für erfolgreiche Nachfolge, Führung und Unternehmensentwicklung
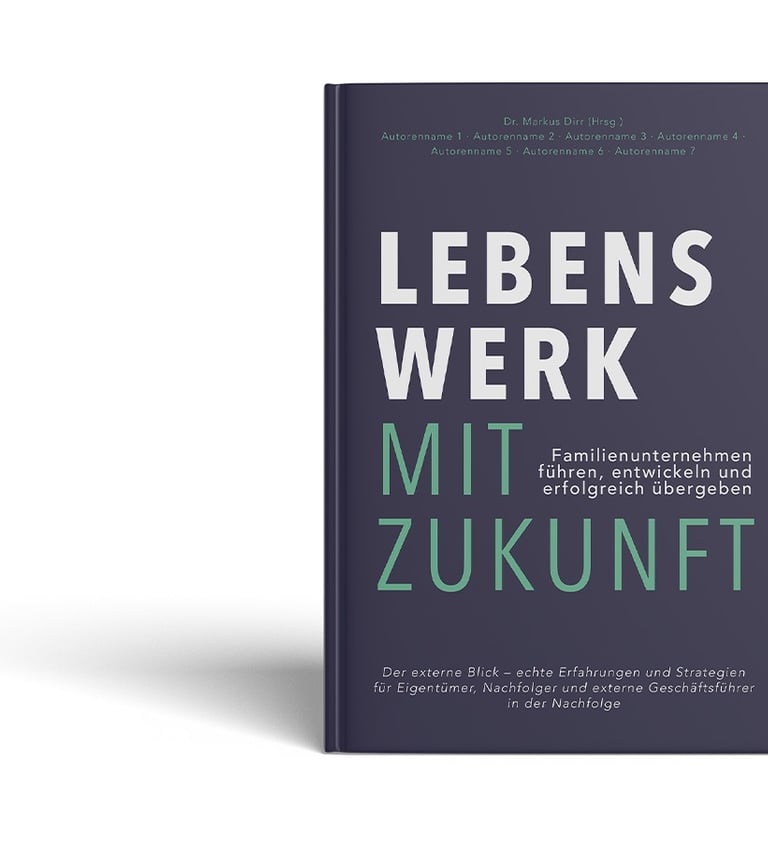
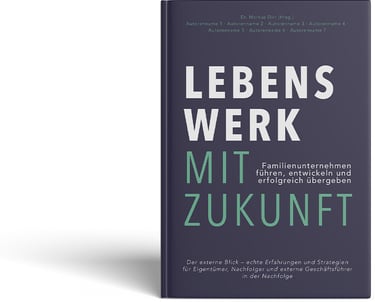
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
Lebenswerk mit Zukunft
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
