Der richtige Partner für Ihren Teilverkauf: Warum kultureller Fit über den Preis entscheidet
Strategische Investoren, Private Equity oder Family Offices – welcher Partner passt zu Ihrem Familienunternehmen? Entscheidende Kriterien für die Partnerauswahl.
Dr. Markus Dirr
7 min lesen
Bei einem Teilverkauf geht es um weit mehr als den höchsten gebotenen Preis. Anders als beim Komplettverkauf steht nicht nur eine einmalige Transaktion im Fokus, sondern der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit, die beide Seiten zufriedenstellen muss. In seinem Beitrag "Von Eigentümer zu Mitgesellschafter: Strategien für einen kontrollierten Teilverkauf" macht Dr. Markus Dirr, externer Geschäftsführer einer Management-Holding im Familienbesitz, deutlich: Die Wahl des richtigen Partners entscheidet maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg.
Die zentrale Erkenntnis: Wer nur auf den Preis schaut, übersieht die kritischen Erfolgsfaktoren einer tragfähigen Partnerschaft. Nichtfinanzielle Faktoren wie strategischer Fit, kulturelle Kompatibilität und gemeinsame Vision sind mindestens ebenso wichtig. Ein niedrigerer Preis kann durch langfristige strategische Vorteile mehr als ausgeglichen werden.
Die verschiedenen Investorentypen im Überblick
Grundsätzlich lassen sich verschiedene Investorentypen unterscheiden, die jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile für Familienunternehmen bieten:
Strategische Investoren sind Unternehmen aus der gleichen oder einer verwandten Branche. Sie bringen wertvolles Branchenwissen, Synergien und oft auch Marktzugang mit. Ihr Engagement ist in der Regel langfristig angelegt, und sie verfolgen operative und strategische Ziele. Die Kehrseite: Sie haben oft eigene strategische Interessen, die im Konflikt mit denen der Familie stehen können. Zudem besteht die Gefahr, dass sie langfristig eine vollständige Übernahme anstreben.
Finanzinvestoren und Private Equity sind auf Beteiligungen an Unternehmen spezialisiert und bringen professionelle Governance-Strukturen, Kapital für Wachstum und oft auch umfassende Transaktionserfahrung mit. Ihre Herausforderung: Sie haben in der Regel einen begrenzten Zeithorizont von drei bis sieben Jahren und sind stark Exit-orientiert. Gerade für Familienunternehmen, die eine langfristige Perspektive verfolgen, kann diese Exitfokussierung problematisch sein. Allerdings haben sich in den letzten Jahren spezialisierte Private-Equity-Fonds entwickelt, die explizit auf die Bedürfnisse von Familienunternehmen ausgerichtet sind und längere Haltedauern anbieten.
Family Offices sind Vermögensverwaltungen anderer Unternehmerfamilien. Sie teilen oft ähnliche Werte und haben einen längeren Anlagehorizont als klassische Finanzinvestoren. Die gemeinsame unternehmerische Denkweise kann eine vertrauensvolle Basis schaffen. Allerdings verfügen Family Offices oft über weniger operatives Know-how als strategische oder Finanzinvestoren und können bei größeren Finanzierungsrunden ihre Grenzen erreichen.
Entscheidende Auswahlkriterien jenseits des Preises
Bei der Partnerauswahl sollten Familienunternehmen eine Reihe kritischer Fragen stellen, die über die reine Finanzierung hinausgehen:
Strategischer Fit: Welche strategischen Vorteile bringt der Partner konkret mit? Passen die langfristigen Ziele zusammen?
Kulturelle Kompatibilität: Teilen beide Seiten ähnliche Werte bezüglich Unternehmensführung, Mitarbeiterumgang und langfristiger Ausrichtung?
Branchenerfahrung: Kennt der Partner die spezifischen Herausforderungen der Branche?
Bisherige Investments: Wie ist der Partner mit anderen Beteiligungen umgegangen? Was sagen Referenzen aus?
Governance-Vorstellungen: Wie stellt sich der Partner die künftige Zusammenarbeit vor? Welche Kontroll- und Mitspracherechte werden erwartet?
Exit-Strategie: Welche Vorstellungen hat der Partner über einen möglichen späteren Ausstieg?
Der Auswahlprozess: Zeit nehmen und gründlich prüfen
Professor Markus Grottke, der zahlreiche Teilverkaufsprozesse begleitet hat, zieht einen treffenden Vergleich: "Es ist wie bei der Partnerwahl im Privatleben. Man sollte sich Zeit nehmen, den anderen wirklich kennenzulernen, bevor man eine langfristige Bindung eingeht. Und man sollte auf sein Bauchgefühl hören – wenn etwas nicht stimmig erscheint, gibt es dafür meist gute Gründe."
Konkret bedeutet dies: Führen Sie intensive Gespräche, holen Sie Referenzen ein und nehmen Sie sich Zeit für den Auswahlprozess. Der richtige Partner kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Teilverkauf und einem kostspieligen Fehlschlag ausmachen. Sprechen Sie mit anderen Unternehmen, an denen der potenzielle Partner beteiligt ist. Wie läuft die Zusammenarbeit? Werden Zusagen eingehalten? Wie wird mit Konflikten umgegangen?
Typische Fehler bei der Partnerauswahl vermeiden
Aus der Praxis lassen sich klare Muster erkennen, welche Fehler bei der Partnerauswahl immer wieder zum Scheitern führen:
Fokus nur auf den Preis: Die Versuchung ist groß, dem Höchstbietenden den Zuschlag zu geben. Doch nichtfinanzielle Faktoren sind für eine langfristige Partnerschaft entscheidender. Ein Partner, der strategisch und kulturell passt, rechtfertigt auch einen geringeren Kaufpreis, wenn die Zusammenarbeit funktioniert und das Unternehmen gemeinsam wächst.
Zu wenig Zeit für den Prozess: Die Suche nach dem richtigen Partner braucht Zeit. Wer unter Zeitdruck entscheidet, übersieht leicht wichtige Aspekte oder akzeptiert Kompromisse, die später bereut werden. Eine sorgfältige Due Diligence sollte in beide Richtungen erfolgen – nicht nur der Investor prüft das Unternehmen, sondern auch umgekehrt.
Unzureichende kulturelle Prüfung: Zahlen und Strategien lassen sich leicht prüfen, Unternehmenskultur und Werte hingegen zeigen sich oft erst im Alltag. Deshalb sind persönliche Treffen, gemeinsame Workshops und der Austausch mit anderen Portfoliounternehmen des Investors so wichtig.
Die Bedeutung von Referenzen und Track Record
Ein verlässlicher Indikator für die Qualität eines potenziellen Partners ist sein Track Record. Wie hat er sich in der Vergangenheit bei anderen Beteiligungen verhalten? Wurden die zugesagten Synergien und Unterstützungsleistungen tatsächlich erbracht? Wie verlief die Exit-Phase bei anderen Investments?
Seriöse Investoren werden bereitwillig Referenzen nennen und den Kontakt zu anderen Unternehmen herstellen, an denen sie beteiligt sind oder waren. Wer dies verweigert oder ausweicht, sollte kritisch hinterfragt werden. Die Gespräche mit Referenzunternehmen sind oft aufschlussreicher als jede Präsentation des Investors.
Die langfristige Perspektive im Blick behalten
Bei aller Euphorie über das zusätzliche Kapital und die strategischen Möglichkeiten sollte die langfristige Perspektive nie aus dem Blick geraten. Ein Teilverkauf ist keine einmalige Transaktion, sondern der Beginn einer Partnerschaft, die idealerweise viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Bestand haben soll.
Wie Dr. Markus Dirr in seinem Beitrag betont: Die sorgfältige Partnerauswahl ist eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren für einen gelungenen Teilverkauf. Nur wenn strategischer Fit, kulturelle Kompatibilität und gemeinsame Vision stimmen, kann eine tragfähige Partnerschaft entstehen, die das Unternehmen wirklich voranbringt.
Der externe Blick macht deutlich: Der höchstbietende Investor ist selten der beste Partner. Familienunternehmen sollten den Mut haben, auch niedrigere Angebote zu akzeptieren, wenn die Chemie stimmt und die langfristigen strategischen Vorteile überwiegen. Diese Entscheidung zahlt sich über die Jahre vielfach aus.
Den vollständigen Originalbeitrag von Dr. Markus Dirr finden Sie im Buch "Lebenswerk mit Zukunft" und einen kostenlosen Auszug unter www.Lebenswerk-mit-Zukunft.de
Was dieses Buch besonders macht: 14 externe Experten teilen ihre authentischen Erfahrungen aus hunderten Nachfolgeprozessen in Familienunternehmen. Von Psychologie über M&A bis zu rechtlichen Fallstricken – jeder Beitrag endet mit konkreten Handlungsempfehlungen. Der konsequent externe Blick deckt jene blinden Flecken auf, die Insider nicht sehen können, und zeigt praxiserprobte Lösungswege statt theoretischer Modelle. Für Eigentümer, Nachfolger und externe Geschäftsführer gleichermaßen wertvoll.
Die Due Diligence in beide Richtungen denken
Während Investoren selbstverständlich eine umfassende Due Diligence des Unternehmens durchführen, vergessen viele Familienunternehmen, dass auch sie den potenziellen Partner gründlich prüfen sollten. Diese umgekehrte Due Diligence ist mindestens ebenso wichtig wie die klassische Unternehmensprüfung.
Konkret bedeutet dies: Analysieren Sie die bisherigen Investments des Partners. Wie lange hält er typischerweise Beteiligungen? Wie ist er mit anderen Portfoliounternehmen umgegangen? Wurden zugesagte Synergien tatsächlich realisiert? Wie verliefen Exit-Prozesse? Sprechen Sie mit Geschäftsführern anderer Beteiligungsunternehmen – nicht nur mit den vom Investor genannten Referenzen, sondern auch mit solchen, die Sie selbst recherchieren.
Die Bedeutung der Investment-Philosophie
Jeder Investorentyp folgt einer spezifischen Investment-Philosophie, die maßgeblich die spätere Zusammenarbeit prägt. Strategische Investoren denken in Marktpositionen und Synergien – sie wollen das Unternehmen in ihre eigene Wertschöpfungskette integrieren. Private-Equity-Investoren denken in Wertsteigerung und Exit-Multiplikatoren – sie wollen den Unternehmenswert in drei bis sieben Jahren maximieren. Family Offices denken in Generationen und Werterhalt – sie wollen langfristige, stabile Renditen.
Keine dieser Philosophien ist per se besser oder schlechter – entscheidend ist, welche zur eigenen Zielsetzung passt. Ein Familienunternehmen, das über Generationen denkt, wird mit einem kurzfristig orientierten Private-Equity-Investor zwangsläufig in Konflikt geraten. Umgekehrt kann ein Unternehmen, das schnelles Wachstum anstrebt, von der Professionalisierungskraft eines Private-Equity-Investors enorm profitieren.
Kulturelle Kompatibilität konkret prüfen
Der Begriff Unternehmenskultur klingt abstrakt, hat aber sehr konkrete Auswirkungen. Wie geht der potenzielle Partner mit Mitarbeitern um? Welche Werte leben die Menschen in seinem Umfeld? Wie werden Entscheidungen getroffen – hierarchisch oder partizipativ? Wie wird mit Fehlern umgegangen – als Lernchance oder als Kündigungsgrund?
Ein praktischer Test ist es, gemeinsame Workshops zu veranstalten, bevor der Vertrag unterschrieben wird. Wie arbeiten die Teams zusammen? Entsteht eine produktive Dynamik oder spürt man Reibung? Passen die Kommunikationsstile zusammen? Diese weichen Faktoren lassen sich nicht in Verträgen regeln, prägen aber den Alltag der Zusammenarbeit fundamental.
Die Rolle persönlicher Chemie nicht unterschätzen
So rational ein Teilverkauf auch erscheinen mag – die persönliche Chemie zwischen den handelnden Personen spielt eine erhebliche Rolle. Wenn die Sympathie fehlt, werden selbst kleine Meinungsverschiedenheiten zu großen Konflikten. Wenn das Vertrauen da ist, lassen sich auch schwierige Situationen konstruktiv lösen.
Deshalb ist es wichtig, nicht nur mit den Deal-Makern des Investors zu sprechen, sondern auch mit jenen Personen, die später die operative Zusammenarbeit prägen werden. Wer wird im Beirat sitzen? Mit wem wird man in strategischen Fragen diskutieren? Diese Personen sollten Sie kennenlernen, bevor die Würfel fallen.
Warnsignale ernst nehmen
Es gibt bestimmte Warnsignale, die im Auswahlprozess ernst genommen werden sollten: Wenn der Investor Druck macht und auf schnelle Entscheidungen drängt, ohne ausreichend Zeit für gegenseitiges Kennenlernen zu lassen. Wenn zugesagte Informationen nur zögerlich geliefert werden oder Referenzen ausweichend behandelt werden. Wenn die Kommunikation uneinheitlich ist und verschiedene Vertreter des Investors widersprüchliche Aussagen machen. Wenn unrealistische Versprechen gemacht werden, die kaum einzuhalten sind.
Diese Signale bedeuten nicht zwangsläufig, dass der Partner ungeeignet ist – aber sie sollten zu vertieften Gesprächen und genauerer Prüfung führen. Wie Professor Grottke sagt: "Auf sein Bauchgefühl hören" bedeutet nicht, irrational zu entscheiden, sondern die Warnsignale ernst zu nehmen, die man unbewusst wahrnimmt.
Die Verhandlung als Charaktertest nutzen
Die Art und Weise, wie der potenzielle Partner verhandelt, sagt viel über die spätere Zusammenarbeit aus. Ist er fair und transparent oder versucht er, einseitige Vorteile herauszuholen? Respektiert er Ihre Interessen oder sieht er nur die eigenen? Wie reagiert er, wenn es schwierig wird – konstruktiv oder konfrontativ?
Seriöse Partner verstehen, dass eine Partnerschaft nur dann funktioniert, wenn beide Seiten zufrieden sind. Sie suchen Win-Win-Lösungen statt Nullsummenspiele. Diese Haltung zeigt sich bereits in der Verhandlung – und sie wird die spätere Zusammenarbeit prägen.
Die Investition in Sorgfalt zahlt sich aus
Die sorgfältige Partnerauswahl braucht Zeit – oft mehrere Monate intensiver Gespräche, Prüfungen und Abwägungen. Diese Zeit ist gut investiert. Denn während eine Transaktion vielleicht nur wenige Wochen dauert, wird die Partnerschaft idealerweise Jahre oder sogar Jahrzehnte bestehen. Ein falscher Partner kann in dieser Zeit enormen Schaden anrichten – finanziell, strategisch und kulturell.
Umgekehrt kann der richtige Partner das Unternehmen auf eine völlig neue Ebene heben, Türen öffnen, die allein verschlossen blieben, und eine Dynamik entfachen, die alle Beteiligten nach vorne bringt. Diese Chance sollte nicht durch Ungeduld oder Fokus auf den falschen Preis verspielt werden.
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
14 Experten teilen Erfahrungen für erfolgreiche Nachfolge, Führung und Unternehmensentwicklung
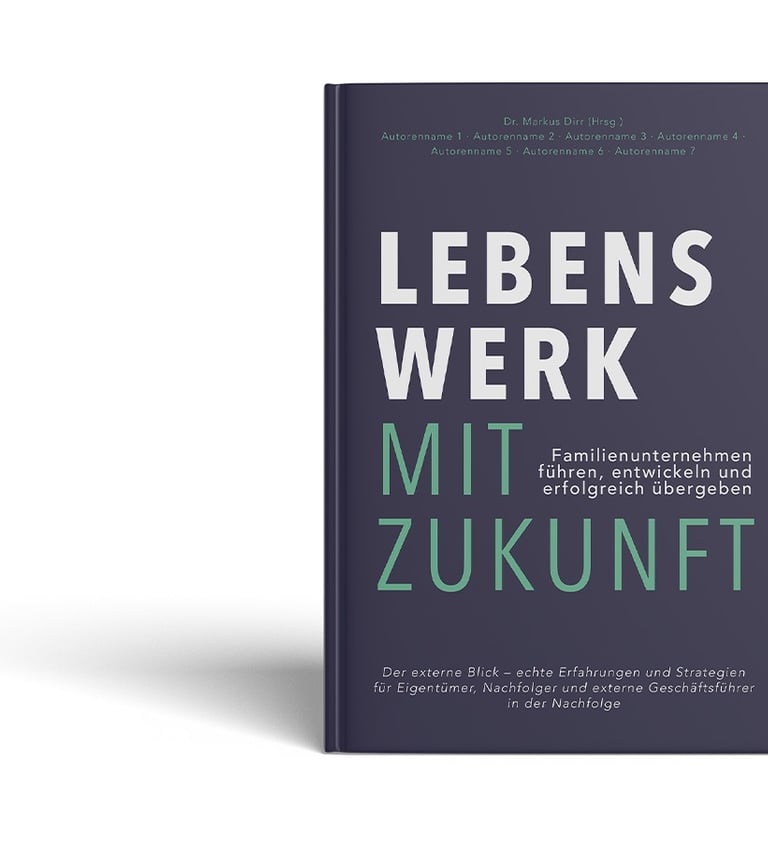
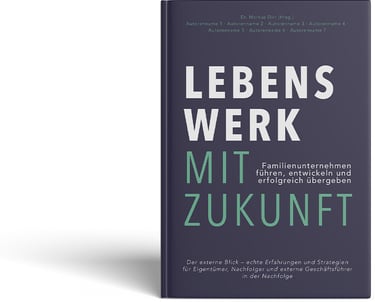
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
Lebenswerk mit Zukunft
Familienunternehmen führen, entwickeln und erfolgreich übergeben
